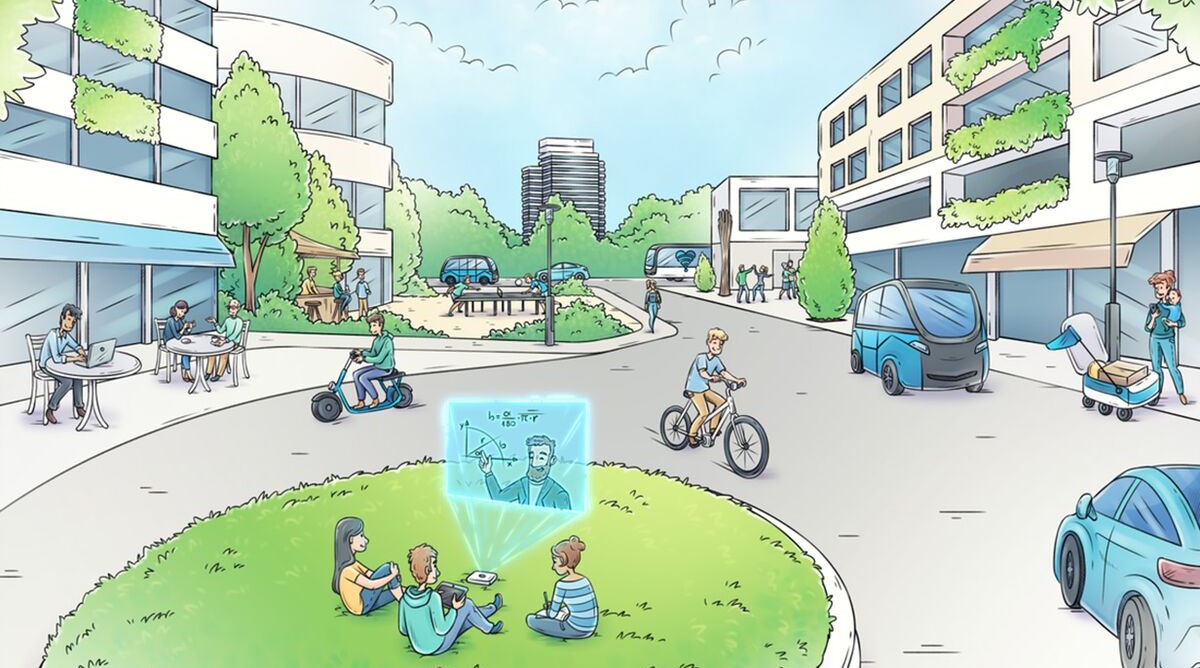
Aus unserem BLOG • Von Christian Reuter und Inga Luchmann, PTV Consult • April 2025
Einsatzfelder für das autonome Fahren im urbanen ÖPNV am Beispiel der Stadt Kaiserslautern
Die Stadt Kaiserslautern beteiligt sich als eine von 73 Experimentierorten am Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities. Ziel des Förderprogramms ist es, Kommunen in Deutschland bei der Entwicklung von Lösungspfaden und der Implementierung von innovativen digitalen Technologien in den städtischen Kontext zu unterstützen. Ein zentrales Handlungsfeld hierbei ist die Digitalisierung im Verkehr. In diesem Zusammenhang war für Kaiserslautern die Frage zu beantworten, welches Potenzial „kleine Einheiten im ÖPNV“ mit autonom und vernetzt fahrenden Fahrzeugen für die Ergänzung und Verstärkung des bestehenden ÖPNV-Angebots haben, für welche konkreten Einsatzfelder im Stadtgebiet sie sich jeweils eignen und wie eine praxisnahe Evaluation zur Optimierung der Einsatzmöglichkeiten aussehen kann.
Eingesetztes Fahrzeug Prototypisches autonomes und vernetztes Fahrzeug
Ursprünglich war vorgesehen, im Rahmen einer Studie Einsatzmöglichkeiten für ein an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau entwickeltes und potenziell vollständig autonom fahrendes Fahrzeug zu ermitteln. Eine Erprobungsgenehmigung für dieses Fahrzeug lag jedoch zum Zeitpunkt der Studie nicht vor. Aus diesem Grund wurde die Studie auf den Einsatz eines prototypischen autonom und vernetzt fahrenden Fahrzeugs (AVF) ausgerichtet. Für das prototypische Fahrzeug wurden Systemeigenschaften angenommen, wie sie aktuell absehbar am Markt vorzufinden sind. Ein solches prototypisches AVF hat eine Masse von rd. 3.500 kg, eine Batteriekapazität von 100 kWh sowie eine maximale Leistung von 80 kW und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 60 km/h. Die Beförderungskapazität ist auf 12 Personen (Sitzplätze und Stehplätze) ausgelegt.
Einsatzfelder für autonomes und vernetztes Fahren im ÖPNV
Als mögliche Einsatzfelder für ein solches prototypisches AVF kommen Räume in Frage, die zu dessen Systemeigenschaften passen. Beispielsweise sollten die Lichtraumprofile im Straßenraum zu den Fahrzeugmaßen passen oder die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten zu den Fähigkeiten des Fahrzeugs. Zudem sollte die zu erwartenden Nutzungszahlen einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb mit den kleinen Fahrzeugen zulassen und die gewählte Betriebsform sollte zur Struktur, d. h. zur räumlichen und zeitlichen Verteilung der Verkehrsnachfrage passen. Eine kleinräumige Analyse der Raum- und Siedlungsstruktur des Stadtgebiets in Kaiserslautern sowie der vorwiegenden Nutzung der Siedlungsflächen (Wohnen, Gewerbe/Arbeiten, Versorgung/Einkauf) ließ entsprechende Rückschlüsse auf Umfang und Struktur der Verkehrsnachfrage zu.
Auch die topografischen Bedingungen im Straßennetz wurden erfasst, da diese einen großen Einfluss auf die Anzahl der Ladezyklen von elektrisch angetriebenen AVF haben und somit auf den Fahrzeugbedarf. Infrage kommen demnach vor allem Räume und Zeiten mit schwacher Verkehrsnachfrage und eher dispers verteilten Verkehrsverflechtungen. Der Einsatz von AVF sollte einen Mehrwert gegenüber der Bedienung mit konventionellen Standardbussen sowohl für die Fahrgäste, durch höheren Komfort, als auch für den Betreiber, durch hohe Wirtschaftlichkeit, bieten. Dadurch rückten vor allem Gebiete und Quelle-Ziel-Relationen außerhalb der Kernstadt in den Fokus (z. B. kleinere, peripher gelegene Ortsteile mit mittleren bis geringen Nachfragepotenzialdichten, großflächige Einkaufzentren und Freizeitziele am Stadtrand), die Lücken, Defizite und Erweiterungsbedarfe im ÖPNV-Angebot aufweisen sowie generell die Schwachverkehrszeiten (Abend- bzw. Nachtstunden und Wochenende). Für diese Räume und Zeiten mit Handlungsbedarf wurden verschiedene Betriebsformen geprüft.
Als potenzielle Einsatzfelder kommen in Kaiserlautern für On-Demand-Ridepooling mit AVF im Flächenbetrieb (d. h. Beförderung zwischen allen Halten im Bediengebiet ohne Linien- und Fahrplanbindung) in der Nebenverkehrszeit rd. 19 % der Siedlungsfläche grundsätzlich in Betracht; in der Schwachverkehrszeit steigt dieser Wert auf rd. 75 %, während diese Betriebsform für die Hauptverkehrszeit nicht eignet. Für die Betriebsform Zubringerverkehr (Sektorbetrieb) sind es in der Hauptverkehrszeit rd. 33 % der Siedlungsfläche, in der Nebenverkehrszeit rd. 50 % und in der Schwachverkehrszeit rd. 51 %, die grundsätzlich für den Einsatz von AVF in Betracht kommen. Für die Betriebsform Punkt-zu-Punkt-Shuttleverkehr im Linienbetrieb auf ausgewählten Relationen (nach Bedarf oder nach Fahrplan) kommt in der Nebenverkehrszeit fast die gesamte Siedlungsfläche in Betracht.
Modellierung von Einsatzszenarien
Um den Einfluss unterschiedlicher raum-, siedlungs- und verkehrsstruktureller Randbedingungen auf den Fahrzeugbedarf und die Performance des Betriebs aufzuzeigen, wurden gemeinsam mit lokalen Akteuren (Stadtverwaltung, Managementgesellschaft KL.digital, ÖPNV-Unternehmen, Verkehrsverbund) schließlich fünf konkrete Einsatzszenarien mit AVF erarbeitet und anhand von Fallbeispielen konkretisiert. Ziel war es, für Kaiserslautern eine möglichst große Bandbreite an Einsatzszenarien im Hinblick auf die o. g. potenziellen Einsatzfelder, unterschiedliche Zielgruppen und Nachfragemuster sowie topografischen Bedingungen aufzuzeigen:
- Einsatzszenario 5.1 und 5.2 (Kombiniertes Einsatzszenario): Binnenerschließung eines Bereichs mit großflächigem Einzelhandel (Mo – Sa) und Punkt-zu-Punkt-Angebot im Freizeitverkehr mit Anbindung an einen SPNV-Haltepunkt (So)
- Einsatzszenario 1: Flächenerschließung eines Ortsbezirks mit mittleren Steigungen und Anbindung an einen Bus-/Bahn-Verknüpfungspunkt
- Einsatzszenario 2: Flächenerschließung eines Ortsbezirks mit größeren Steigungen und Anbindung an Bahn-Haltepunkte und an ein Freizeitziel
- Einsatzszenario 3: Anbindung eines Wohn- und Gewerbegebiets mit geringen Steigungen an einen SPNV-Haltepunkt
- Einsatzszenario 4: Punkt-zu-Punkt-Angebot im Freizeitverkehr
Nachfragepotenzial, Tourendauer und Flottengröße
Die in den Einsatzszenarien jeweils erschlossenen Nachfragepotenziale (bestehend aus der Summe der Einwohner und Beschäftigten sowie ggf. die geschätzte Anzahl von Kunden oder Besuchern) liegen zwischen 2.800 und 5.900 das AVF nutzenden Personen pro Tag, wobei das AVF für eine Tour ab dem Startpunkt bis zur Rückkehr zum Startpunkt zwischen 8 min (Szenario 2) und 34 min (Szenario 5.1) benötigt. Unter Berücksichtigung der zeitlichen Verteilung der Nachfrage über den Tag und der jeweiligen topografischen Verhältnisse werden je nach Szenario entweder 4 Fahrzeuge (Szenario 2 und 5.1) oder 2 Fahrzeuge (übrige Szenarien) benötigt.
Fazit
Vor dem Hintergrund eines sich verstärkenden Fahrpersonalmangels im ÖPNV möchte die Stadt Kaiserslautern mit dem AVF-Einsatz das ÖPNV-Angebot ergänzen und so die Attraktivität des ÖPNV stärken. Die Stadt hat durch die Analyse, welche PTV Transport Consult gemeinsam mit dem Institut für Fahrzeugsystemtechnik des Karlsruher Instituts für Technologie vorgelegt hat, eine gute Ausgangsbasis, um mit dem Einsatz von AVF zu starten. Weitere Informationen zur Einführung autonomer ÖPNV-Angebote finden Sie im Handbuch zum autonomen Fahren im öffentlichen Verkehr, ein Handbuch mit Vorschlägen für die Umsetzung in der kommunalen Praxis.
Über die PTV
Die PTV Transport Consult GmbH ist das Beratungsunternehmen innerhalb der PTV Group. Die Mobilitätsexpertinnen und -experten erstellen Studien und Konzepte für eine nachhaltige, aber dennoch wirtschaftliche Mobilität der Zukunft und unterstützen den Klimaschutz im Verkehrswesen, für Wirtschaftsverkehre und die Verkehrssicherheit. Weitere Informationen unter: https://consult.ptvgroup.com/de
Wir sind für unseren Blog immer auf der Suche nach spannenden Projekten und Vorhaben aus dem Bereich der automatisierten und vernetzten Mobilität – sprechen Sie uns einfach über kommunikation@innocam.nrw an!